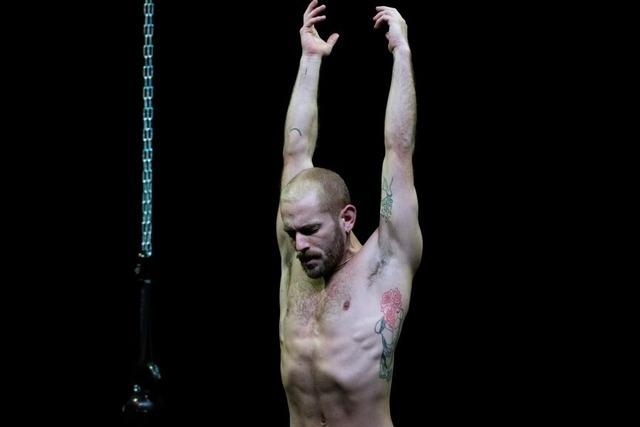Essay
Das Publikum kehrt dem Theater verstärkt den Rücken. Warum?
Das Regietheater steckt in der Krise. Das hat viele Gründe. Corona, Krise, Krieg. Ein veränderter Bildungskanon. Aber vor allem vermisst das Publikum Illusion und Emotion. Eine Bestandsaufnahme.
Mi, 17. Aug 2022, 19:00 Uhr
Theater
Wir benötigen Ihre Zustimmung um BotTalk anzuzeigen
Unter Umständen sammelt BotTalk personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.
Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.
AkzeptierenMehr Informationen
Was sich während der 90 Minuten Filmdauer ereignet, sind Läuterungsprozesse. Man erfährt, warum getrauert wird, wie getrauert wird, und man erlebt, wie wildfremde Menschen aufeinander zugehen oder auch voneinander abgestoßen werden. Allmählich beginnt man mit den beiden Entführern zu sympathisieren, und nach und nach kommen die sich auch mit ihren Opfern näher. Am Ende gibt es einen Toten, den verletzten Entführer – und irgendwie geht die Sache allen näher, als sie es sich hätten vorstellen können. Die Zuschauer inklusive.
Die Geschichte wird elegant über die Stilgrenzen hinweg erzählt: ein wenig naturalistisches Rührstück, ein wenig Drama, ein wenig Groteske. Aber sie hat ein klares Narrativ, sie bleibt auf dem Boden, sie braucht keine komplexen, abstrakten Bilder, die womöglich das Verständnis erschweren. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb sie so unmittelbar wirkt.
Wann ist mir eine Aufführung im Musiktheater zuletzt so richtig nahegegangen? Ich muss länger nachdenken. Oper kann durch die Ebene der Musik, die alles andere zu dominieren vermag, ganz anders berühren. Dazu bedarf es nicht einmal der Worte, es genügen Klänge. Zur Ankunft Cio-Cio-Sans, genannt Butterfly, im ersten Akt von Giacomo Puccinis "Madama Butterfly" mit ihren Freundinnen im Hause ihres zukünftigen Mannes Pinkerton erklingt eine besonders sinnliche, besonders intime, aber im Grunde auch tieftraurige Musik. Sie zieht wohl die meisten Hörer regelrecht in einen Sog der Gefühle. Benedikt Arnold hat das in der vergangenen Spielzeit am Theater Freiburg in ganz schlichte Bilder gekleidet, die ihre Wirkung aber nicht verfehlt haben. In Andreas Homokis aktueller Inszenierung auf der Bregenzer Seebühne sind die Bilder opulenter, ein unendlich wirkender Zug von Frauen kommt in Serpentinen vom hinteren, oberen Ende der Bühne nach vorne. Auch hier gelangen Musik und Szene zu einer gemeinsamen kraftvollen Sprache – das eine verstärkt das andere. Und noch etwas: In beiden Fällen kann auch jemand, der zum ersten Male diese Oper auf der Bühne erlebt und deren Handlung vielleicht zuvor im Opernführer gelesen hat, das Stück nachvollziehen. Es verstehen.
Verständnis, Empathie und Illusion sind in der darstellenden Kunst sicher Größen, die sich isoliert betrachten lassen. Wirken sie aber zusammen, ist das Ergebnis für alle Beteiligten, insbesondere das Publikum, weit befriedigender. Doch genau das scheint immer seltener der Fall zu sein. Sich darüber Gedanken zu machen, ist in der aktuellen Situation der Theater mit allerorts zu verzeichnendem Publikumsschwund und einer wachsenden Distanz der Gesellschaft zu ihren tradierten Bildungsgütern notwendig, wenn nicht überlebenswichtig.
Dabei lohnt ein kurzer Exkurs in die Geschichte: Warum entwickelte sich die Theaterregie dorthin, wo sie heute steht? Dazu muss man mindestens in die 1920er Jahre zurückgehen, als die Kritik an der Gattung Oper lauter wurde und man vom "Opernmuseum" zu sprechen begann. Die Repertoires verkrusteten immer mehr, von Mozart bis Richard Strauss. Stücke wurden also immer wieder neu aufgeführt, inszeniert. Dem (Volks-)Theater aber erwuchs eine große Konkurrenz im neuen Medium Film. In jener Zeit schlug die Geburtsstunde des avancierten Musiktheaters. Opernregie wurde, zumal nach 1945, zu einem intellektuellen Experimentierfeld mit antibürgerlicher Haltung. Die Oper verlor dadurch ihre Massentauglichkeit.
Walter Benjamin, der hellsichtige Philosoph und Kulturkritiker, hat diesen Umstand früh beschrieben: "Je mehr nämlich die gesellschaftliche Bedeutung einer Kunst sich vermindert, desto mehr fallen...die kritische und genießende Haltung im Publikum auseinander. Das Konventionelle wird kritiklos genossen, das wirklich Neue kritisiert man mit Widerwillen." Diese Feststellung hat ihre Gültigkeit bis in die Gegenwart hinein nicht verloren. Verliert die Oper, verliert das Theater weiter an gesellschaftlicher Bedeutung – und darauf deutet manches im Moment hin –, könnte der "Widerwillen" beim verbleibenden Publikum wachsen. Oder das Unverständnis. Beides führt zum selben Ergebnis – man kehrt dem Theater den Rücken.
Die, die es bereits getan haben, geben häufig als Grund dafür an, dass sie der Ästhetik der Inszenierungen, den Interpretationsansätzen nicht mehr folgen wollen. Hinzu kommt in Zukunft wohl auch alternativ das Verb "können". In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der sogenannte Bildungskanon drastisch verändert – zuungunsten des literarischen, dramatischen und musikalischen Erbes. Wenn Goethes "Faust", wie es jetzt ein Bundesland mit bislang eher konservativer Haltung wie Bayern plant, nicht mehr Pflichtlektüre in der gymnasialen Oberstufe ist, lässt sich das auch als Signal werten. In Richtung Beliebigkeit. Was aber in der Schule nicht mehr stattfindet, hat auch im späteren Leben nur noch wenig Chancen auf intellektuelle und emotionale Aneignung. Kann man dann jemandem eine erste Begegnung mit dem Stoff auf der Bühne zumuten wie etwa in der vergangenen Spielzeit am Theater Freiburg in Krzysztof Garbaczewskis Inszenierung als digital-analoger Hybrid? Kaum.
Das deutsche Regietheater hat sich in den vergangenen Jahrzehnten an den Klassikern in Schauspiel und Oper abgearbeitet. Mit ebenso unproduktiven wie brillanten Ergebnissen. In den Zeiten des Bildungsbürgertums waren es richtige Kämpfe mit dem Publikum, das die künstlerische Organisation einer Inszenierung mit all ihren Verfremdungsmitteln als Affront gegen Werk und Autor, vor allem aber gegen sich begriff. Nach und nach trat ein Gewöhnungseffekt ein. Das Beispiel des Regisseurs Hans Neuenfels mag das unterstreichen: In seinen jungen Jahren als Regieberserker von Publikum und den konservativen Teilen der Kritik angefeindet und gehasst, wurde der späte Neuenfels geradezu euphorisch gefeiert. Etwa mit seinem Bayreuther "Lohengrin" (2010), der Wagners romantische Oper um den Schwanenritter inmitten einer Welt von Ratten ansiedelte. Noch 30 Jahre vorher hätte man ihn dafür ausgebuht.
Bayreuth ist vielleicht ein Symptom für die Krise des Regietheaters. Der Neuinszenierung des "Ring des Nibelungen" von Valentin Schwarz widerfuhr nach der Premiere das heftigste Buh-Konzert seit langem an diesem Ort. Aber warum? Tat Schwarz nicht das, was auch seine Vorgänger immer versuchten: das Weltendrama in zeitgemäßen Bildern zu erzählen, um damit der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten? Ganz offenbar nicht. Publikum und Kritik urteilten in seltener Einmütigkeit. Schwarz und sein Team hätten die Sinnhaftigkeit verweigert. Ihre Bilder und Metaphern seien willkürlich und führten ins Leere oder widersprächen einander, es mangele an Regiehandwerk.
Was dieser "Ring" indes auch nur ganz selten vermochte: anrühren, berühren, einem die Figuren nahe bringen. Gerade das war immer eine Stärke des Theaters, schon aufgrund des direkten Kontakts zu seinem Publikum. Jeder Protagonist, jede Protagonistin in dem neuen Film "Nichts zu verlieren" erfährt von ihrer Regie mehr Empathie als die Figuren in jener Neuinszenierung eines Klassikers. Das spricht nicht für die Kraft des Repertoire-Theaters.
Der aktuelle Rückgang an Zuschauerzahlen dort hat noch viele andere Ursachen: die gewaltige Zäsur durch Corona, die Inflation. Ganz allgemein: die wachsenden Zukunftsängste. Und die Energiekrise könnte im Herbst und Winter die Theater vor ganz neue Herausforderungen stellen. Einfluss haben sie indes auf ihr Verhältnis zum Publikum. Weitermachen wie im 20. Jahrhundert, sprich: die Regie sich abstrakt und autistisch abarbeiten lassen an den großen Stoffen und dem Publikum abverlangen, sich gefälligst damit auseinanderzusetzen, geht nicht mehr. Wenn das Publikum die Stücke immer weniger kennt, hat es keinerlei Bedürfnis, mit deren Auslegung auf irgendwelchen Metaebenen konfrontiert zu werden. Und wenn das Publikum vom Film, ob im Kino oder gestreamt, mehr berührt wird als vom Theater, wird es ganz schwierig. Was das Theater braucht – es sind die großen Erzählungen. Übrigens gerade auch dort, wo es zeitgenössisch und experimentell ist. Und Menschen, die sie glaubwürdig vortragen – oder interpretieren.