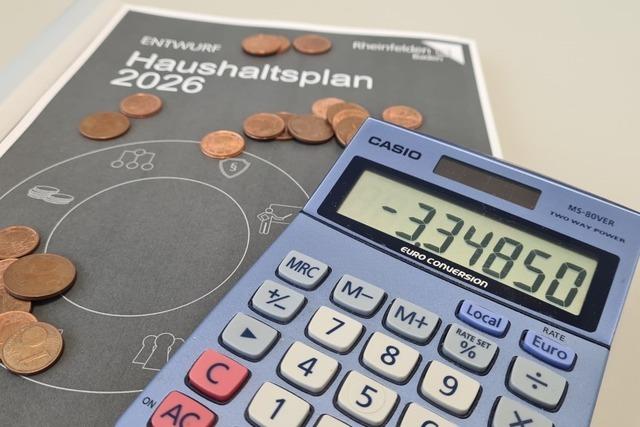BZ-Interview
Leiterin des Hertener Josefshauses fordert Umdenken bei der Inklusion
Welche Herausforderungen birgt das Thema Inklusion in Schule und Gesellschaft? Das beantwortet Birgit Ackermann, Geschäftsführerin des St. Josefshauses in Herten, im Interview.
Sa, 15. Sep 2018, 15:00 Uhr
Rheinfelden
Wir benötigen Ihre Zustimmung um BotTalk anzuzeigen
Unter Umständen sammelt BotTalk personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.
Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.
AkzeptierenMehr Informationen

BZ: Woran kann man gelungene Inklusion festmachen? Nach welchen Kriterien lässt sie sich messen?
Ackermann: Das in Zahlen zu messen ist schwierig. Die Anzahl von Förderschülern in allgemeinbildenden Schulen kann ein Indikator sein. Aber die Frage für uns in der schulischen Bildung ist die Frage der Anschlussmöglichkeiten. Wenn ein Kind in einen inklusiven Kindergarten gegangen ist, muss es die Möglichkeit haben, in der Grundschule und danach in einer weiterführenden Schule inklusiv beschult zu werden. Die Gesellschaft verändert sich erst, wenn durch alle Systeme hindurch eine ...