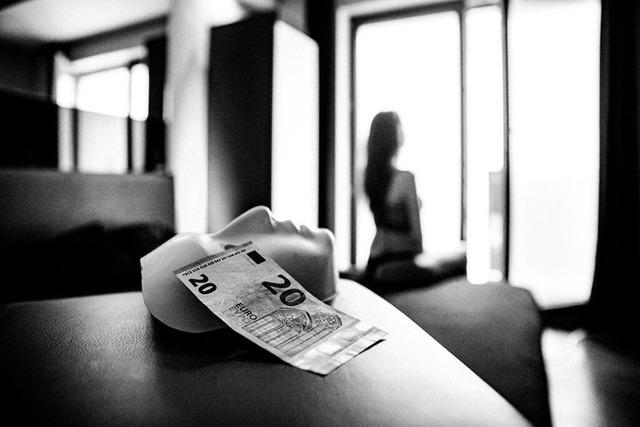Migration und Heimat
Fotoalben vermitteln ein Lebensgefühl, wie nach Offenburg ausgewanderte Russlanddeutsche in der Sowjetunion lebten
Sie sind eine Quelle für die Lebensformen der Deutschen, die aus Russland nach Offenburg gekommen sind. Ein Vortrag im Ritterhaus erläuterte dei Hintergründe.
ske
So, 30. Okt 2022, 15:30 Uhr
Offenburg
Wir benötigen Ihre Zustimmung um BotTalk anzuzeigen
Unter Umständen sammelt BotTalk personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.
Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.
AkzeptierenMehr Informationen

Dass der Ukraine-Krieg während der Vorbereitungen zur Ausstellung sie in eine besondere Lage bringen würde, war nicht vorhersehbar, sagte Wolfgang Reinbold, Leiter der neune städtischen Abteilung Stadtgeschichte und Heimatpflege, im Gespräch. Es zeige aber, wie wesentlich die Frage der eigenen Identität für die Russlanddeutschen immer noch ist. Das rege Interesse an der Ausstellung und die Bereitschaft, private Erinnerungsstücke und Fotoalben zur Verfügung zu stellen, zeigen das.
Speziell über den Erkenntnisgewinn aus privaten Fotoalben der Deutschen aus Russland für die wissenschaftliche Arbeit hielt die Sozial- und Kulturanthropologin Natalja Salnikova von der Albert-Ludwigs- Universität Freiburg im Museum einen interessanten Vortrag. "Sie ist eine ausgewiesene Kennerin auf dem Feld der privaten Fotografien und hat uns bei unserer Ausstellung hier beratend zur Seite gestanden", sagte Museumsleiterin Valerie Schoenenberg bei der Vorstellung der Vortragenden, die selbst in Kasachstan geboren wurde und mit Eltern und Schwester 1997 den Großeltern folgend nach Deutschland ausreiste.
Die ersten Teile ihres "digitalen Fotoalbums" zeigten Fotos der eigenen Familie. Das Hochzeitsfoto der Eltern, die am Tag der Oktoberrevolution 1977 geheiratet hatten, gibt schon viele Informationen: Das sowjetische Fest war im säkularisierten Russland neben dem Tag der Arbeit, dem Tag des Sieges über den Nationalsozialismus und dem Neujahrsfest (statt Weihnachten) ein wichtiger kultureller Baustein. Statt in die Kirche zu gehen, legte man Blumen am Grabmal des Unbekannten Soldaten ab.
"Meine Mutter kommentiert dieses schwarzweiße Foto immer und weist darauf hin, dass sie hier rotlackierte Fingernägel hatte, die genau zur Krawatte meines Vaters passten. Das zu bewerkstelligen, sei zur Zeit der Mangelwirtschaft eine sehr schwierige Sache gewesen", berichtete Salnikova. Sie wies darauf hin, wie das gemeinsame Betrachten der Familienfotos so dazu beitrage, dass für die jüngere Generation ein lebendiges Bild von der Vergangenheit entstehen könne." Es werden Fragen angeregt, Gespräche entstehen, Wissen wird weitergegeben". Da Fotografieren teuer war und der Erwerb einer Kamera nicht jedem möglich, waren die Besitzer auf allen Geburtstagen, Familienfesten, beim Eintritt in Schule und Kindergarten und bei Beerdigungen gefordert.
Gefragt, warum so viel Materielles wie Autos und Einrichtungsgegenstände, aber kaum Landschaft auf solchen Fotos zu sehen ist, sagte die Vortragende: "Die Landschaft wurde nicht als etwas Besonderes wahrgenommen, sie war einfach da. Wenn man aber endlich nach langem Warten einen Lada bekommen konnte, dann war das ein Foto wert."
Natalja Salnikova
Es gibt Beispiele, wo die emaillierten Fotoplaketten auf den Grabsteinen abmontiert und nach Deutschland mitgenommen wurden, um die Erinnerung zu stützen".
Am Beispiel eines stolzen "Wir waren da"- Fotos einer Familie vor der monumentalen Statue von Mütterchen Russland in Wolgograd (Stalingrad) deutete Salinkova auf die Ambivalenz dieses Fotos hin: "Es gibt ja kaum eine russlanddeutsche Familie, die nicht unter dem Terror Stalins gelitten hat, Angehörige verloren hat, Verschleppung und Lager erleben musste".
Nach dem Vortrag konnte das Publikum in den Fotoalben der drei Leihgeberinnen Elvira Tissen, Maria Koch und Margarita Galkin blättern und mit ihnen ins Gespräch kommen.