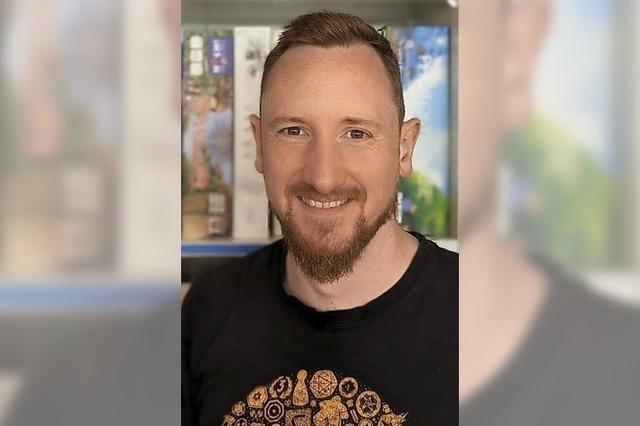Ausblick
2022 ist da – Zeit für Prognosen für die Region, aber wie entstehen die?
Wird 2022 ein heißes Jahr? Drohen Hochwasser? Was sagt der Mond über das nächste Jahr aus? Experten erzählen von Vorhersagen für das neue Jahr.
Wir benötigen Ihre Zustimmung um BotTalk anzuzeigen
Unter Umständen sammelt BotTalk personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.
Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.
AkzeptierenMehr Informationen

Die Wetterexpertin
Wie wird das Wetter, fliegen Pollen, was ist mit der UV-Belastung? Eine, die Antworten auf solche Fragen sucht, ist Carola Grundmann vom Freiburger Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes. "Mein Traumjob", sagt die Diplom-Ingenieurin für Meteorologie, Jahrgang 1960, wenn sie erzählt, wie aus Milliarden von Daten, weltweit gesammelt über Wetterwarten und -ballons, Satelliten, Flugzeuge, Schiffe und ...