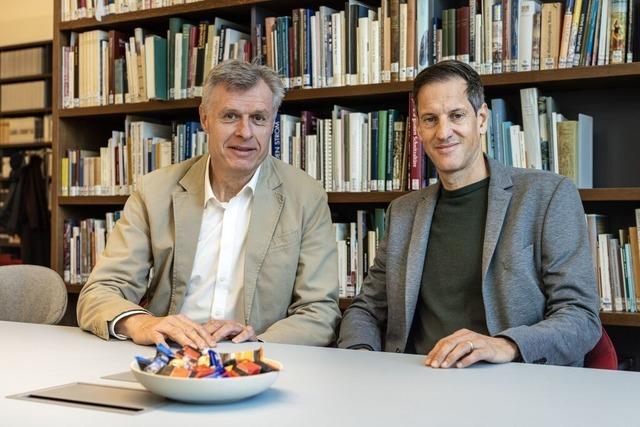Bürgerpreis der Deutschen Zeitungen
Friederike und Clemens Ladenburger: "Sie lebt weiter mit uns"
Im Herbst 2016 haben sie ihre Tochter Maria verloren – durch einen Mord, der Freiburg und die Republik erschüttert hat. Nun erhält das Ehepaar Ladenburger den Bürgerpreis der Deutschen Zeitungen.
Joachim Frank & Stefan Hupka
Fr, 8. Mär 2019, 20:25 Uhr
Freiburg
Thema: Fall Maria L.
Wir benötigen Ihre Zustimmung um BotTalk anzuzeigen
Unter Umständen sammelt BotTalk personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.
Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.
AkzeptierenMehr Informationen
BZ: Frau Ladenburger, Herr Ladenburger, einen Tag, bevor im März 2018 das Urteil gegen den Mörder Ihrer Tochter erging, haben Sie die Gründung der nach ihr benannten Maria-Ladenburger-Stiftung bekanntgegeben. Warum wählten Sie gerade diesen Zeitpunkt?
Clemens Ladenburger: Es hat sich glücklich gefügt, dass wir mit den Vorbereitungen für die Stiftung zu diesem Zeitpunkt fertig waren, dank der großartigen Zusammenarbeit mit dem Verband der Freunde der Universität Freiburg. Es war unser Wunsch, dass die Erinnerung an unsere Tochter nicht nur mit diesem entsetzlichen Verbrechen verbunden sein soll, sondern mit ihrem Leben. Deshalb haben wir dafür auch bewusst Marias vollen Namen verwendet, der bis dahin in der Öffentlichkeit und in den Medien ja immer nur abgekürzt verwendet werden durfte. Aber jetzt dachten wir: Im Kontext der Stiftung ist es uns recht.
Friederike Ladenburger: Sie hat sich seit Sommer 2017 aus vielen kleinen Puzzlesteinen zusammengefügt. Wir haben eine große Dankbarkeit empfunden, dass wir Maria geschenkt bekommen hatten und mit ihr eine ganz besondere – wenn auch viel zu kurze – Zeit erleben durften. Deshalb wollten wir anderen Studierenden etwas schenken, was Marias Wirken und ihrer Ausstrahlung entsprechen und ein Zeichen der Mitmenschlichkeit in ihrem Sinne setzen sollte. Unsere beiden anderen Töchter haben unsere Überlegungen übrigens stark mitgeprägt.
Clemens Ladenburger: Es ist uns im Lauf der Zeit auch klar geworden, dass es eine Stiftung in und für Freiburg sein sollte. Einmal, weil Maria als Studentin dort ein wunderschönes Jahr hatte. Dann aber auch, weil meine Frau und ich uns der Stadt sehr verbunden fühlen. Wir haben beide in Freiburg studiert, haben uns dort kennengelernt und sehr glückliche Jahre verbracht. So dachten wir, es wäre gut, etwas für die Menschen in Freiburg zu tun, die das schreckliche Geschehen so hautnah mitbekommen hatten. Deshalb haben wir den Verband der Freunde der Universität angerufen und ihm unsere Idee unterbreitet...
Friederike Ladenburger: ... von einer Investition in Bildung. Maria war selbst ein sehr weltoffener, interessierter Mensch. Die Bildungsmöglichkeiten, die sich ihr in Freiburg boten, hatte sie mit unglaublicher Intensität und Freude wahrgenommen. Also haben wir die Universität gefragt: Wo gibt es Bedarf, junge Menschen auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen? Die damalige Dekanin der medizinischen Fakultät wies dann darauf hin, dass unterschiedlichste Probleme den Studienablauf erschweren können und auch ausländische Studierende es nicht immer einfach haben.
Clemens Ladenburger: Maria, die in Brüssel aufgewachsen war, kam ja gewissermaßen auch aus dem Ausland, auch wenn Deutschland ihr nicht fremd war. Sie hatte sich dann sehr bewusst für ein Studium in Deutschland entschieden, weil das Land ein Teil ihrer Identität war, der ihr bislang nicht so vertraut war.
BZ: Und ebenso klar war ihr auch, dass es ein Medizinstudium sein sollte?
Friederike Ladenburger: Maria hatte ein besonderes Gespür für andere Menschen und ein Talent, sich ihnen zuzuwenden. Schon im Jahr vor dem Schulabschluss entwickelte sich daraus der feste Wunsch, Ärztin zu werden. Erste Erfahrungen und auch die Rückmeldungen aus drei Pflegepraktika haben sie darin ermutigt und bestärkt.
BZ: War Freiburg nach dem Verbrechen kein kontaminierter Ort für Sie?
Clemens Ladenburger: Also, ja, natürlich… sag du mal!
Friederike Ladenburger: Sehen Sie: Wir sind zuerst und vor allem trauernde Eltern. Darum ist es uns nach Marias Tod natürlich sehr schwer gefallen, wieder gerne nach Freiburg zu kommen. Das braucht Zeit. Aber wie Maria uns in Gesprächen, Briefen und anderen Aufzeichnungen so vieles hinterlassen hat, was uns Kraft gibt, so hat uns auch der Gedanke geholfen, dass sie in Freiburg bis zu ihrem Tod eine glückliche Zeit hatte.
Clemens Ladenburger: Nicht zuletzt hat die Stiftungsarbeit uns wieder ein positives Verhältnis zu Freiburg gewinnen lassen. Die Vorstellung der Stiftung im vorigen November mit einem kleinen Festakt war für uns ein sehr freudiges Ereignis. Es war eine emotionale Anstrengung hinzufahren, aber zurückgekehrt sind wir mit einem Gefühl großer Erleichterung.
BZ: Sollte es einen eigenen Gedenkort in der Nähe des Ortes des Verbrechens geben?
Clemens Ladenburger: Wir sind darüber im Gespräch mit dem Oberbürgermeister.
Die Studentin Maria Ladenburger ist im Oktober 2016 Opfer eines Sexualverbrechens geworden. Nach sieben Wochen dauernden Ermittlungen nahm die Polizei Freiburg Hussein K. fest – einen nach eigenen Angaben minderjährigen Flüchtling aus Afghanistan. Am 5. September 2017 begann der Prozess gegen K. vor dem Landgericht Freiburg. Das Urteil wurde nach 24 Verhandlungstagen am 22. März 2018 gefällt: Gegen Hussein K. wurde die Höchststrafe verhängt. Alle Texte zu dem Fall in der Übersicht.
BZ: Sind Sie schon einmal dort gewesen?
Clemens Ladenburger: Nein. Das ist ein Ort, der uns aufgezwungen wurde und den wir in nächster Zeit nicht aufsuchen wollen.
Friederike Ladenburger: Wir haben stattdessen den Friedhof in Brüssel, auf dem Maria begraben ist.
Clemens Ladenburger: Aber es hat uns gefreut, dass es Marias Freunden und Kommilitonen ein Anliegen ist, dort an der Dreisam, wo Menschen schon jetzt an Maria denken, den Ort besonders zu gestalten, weil es ihrem Gedenken an Maria hilft. Das unterstützen wir.
BZ: Im Prozess gegen den Täter waren Sie Nebenkläger. Wie sind Sie an das Verfahren herangegangen? Sie haben sich dazu ja nie öffentlich geäußert.
Friederike Ladenburger: Wir haben es als unsere Pflicht angesehen, als Nebenkläger unseren Beitrag zur juristischen Aufarbeitung zu leisten. Dafür haben wir uns einen sehr kompetenten Anwalt gesucht, Professor Bernhard Kramer. Er hat uns sehr geholfen und uns fortlaufend detailliert informiert. Wir selbst waren bewusst nicht im Gerichtssaal. Wir wollten uns so ein Stück Distanz bewahren.
BZ: Welchen Auftrag haben Sie ihm gegeben?
Clemens Ladenburger: Wir wollten ein möglichst konstruktives, sachliches Vorgehen im Dienste der Rechtsprechung. Aber keinen von unserem Anwalt zusätzlich angefachten Medienrummel, keine politischen Begleitstatements, keine Überlagerung des Prozessverlaufs durch emotionale Einlassungen seitens der Opfer, also von uns. Nur zum Beginn und am Tag des Urteils haben wir jeweils eine Erklärung veröffentlicht.
BZ: Wer im Gerichtssaal saß, konnte einen weisen, fast milden Stil Ihres Prozessvertreters erleben, der nicht die Spur von Bitterkeit, dem Wunsch nach Vergeltung oder politischer Anklage erkennen ließ. War das Ihr ausdrücklicher Wunsch?
Friederike Ladenburger: Der Stil entsprach unseren Vorstellungen. Mein Mann und ich, wir sind beide Juristen. Wir wollten, dass die Wahrheit gesucht und die Tat angemessen geahndet wird – so gut es in einem Rechtsstaat geht. Und wir glauben, das ist in diesem Verfahren geradezu vorbildlich gelungen. Ganz unabhängig davon bestehen unsere persönliche Trauer und unsere Fassungslosigkeit über diese grauenhafte Tat. Ich glaube, es war für uns wichtig, so weit wie möglich die Verschiedenheit beider Ebenen zu erkennen und sie auseinanderzuhalten.
BZ: Hatten Sie nie den Gedanken, dem Täter einmal Auge in Auge gegenüberzustehen?
Clemens Ladenburger: Wir haben das offengehalten. Es war jedenfalls nicht von vornherein klar, dass wir dem Prozess von Anfang bis Ende fernbleiben würden. Aber im Verlauf haben wir uns dann gefragt: Möchte Maria, dass wir da hingehen? Und wir sind zum Ergebnis gekommen: Nein, das möchte sie nicht. Außerdem haben wir aufgrund des Täterprofils und seines Verhaltens vor Gericht zunehmend den Eindruck gewonnen, dass wir mit einer persönlichen Konfrontation nichts erreichen und auch uns damit nicht helfen würden.
Friederike Ladenburger: Sie kommen an der Person des Täters nicht vorbei. Etwas anderes anzunehmen, wäre naiv, und nach einer Erfahrung, wie wir sie machen mussten, ist man vieles, aber naiv ist man nicht mehr. Der Täter hat uns und allen, denen Maria etwas bedeutet hat, unermessliches Leid zugefügt, das er durch sein Verhalten im Prozess noch gesteigert hat. So haben wir es zum Prozessende formuliert, und mehr möchten wir auch heute eigentlich nicht sagen. Da kommen Fragen auf, die zu schwer für uns sind…
Clemens Ladenburger: … und die wir deshalb an unseren Gott abgeben.
BZ: Als den höchsten Richter?
Clemens Ladenburger: Gott weiß, was aus diesem Menschen noch werden kann.
BZ: Sie betonen die Funktionsfähigkeit des Rechtsstaats. Aber der Prozess brachte auch ein Versagen der Behörden ans Licht – in Deutschland wie zuvor in Griechenland. Die falsche Altersangabe des Täters wurde ihm geglaubt, seine Vorstrafe war nicht bekannt. Haben Sie angesichts solch haarsträubender Erkenntnisse nicht mit den eklatanten Mängeln des Rechtsstaates oder gar mit der ganzen Willkommenskultur gehadert?
Clemens Ladenburger: Wir haben es uns sicher nicht ausgesucht, dass ausgerechnet das Schicksal unserer Tochter – "der Fall Maria L." – zusammen mit anderen schlimmen Vorkommnissen…
BZ: … wie der Kölner Silvesternacht 2015/2016…
Clemens Ladenburger: … eine Reihe von Fragen aufgeworfen hat, die den politischen und gesellschaftlichen Akteuren zuvor nicht so deutlich waren, die aber offen diskutiert werden müssen.
Clemens Ladenburger: Nun, Fragen wie die nach den Zusammenhängen von Migration und innerer Sicherheit; nach den Kontrollen in Asylverfahren; nach der Zusammenarbeit in Europa und nicht zuletzt nach den großen Herausforderungen der Integration. Auch uns treiben diese Fragen um – als Juristen und als politisch denkende Menschen. Es ist wichtig, dass über diese Fragen diskutiert wird, auch kontrovers diskutiert wird. Aber wir wünschen uns, dass das sachlich geschieht und mit Respekt vor der Einstellung und der Herkunft des anderen. Wir haben uns mehrfach die Frage gestellt, ob wir als Opfer nicht doch selbst einmal Stellung beziehen sollten…
Friederike Ladenburger: … und wir haben uns durchaus unter Schmerzen dafür entschieden, das nicht zu tun.
BZ: Unter Schmerzen?
Clemens Ladenburger: Ja, schließlich mussten wir miterleben, wie das Schicksal unserer Tochter instrumentalisiert wurde, wie mit ihrem Namen Hass geschürt wurde. Natürlich hatten wir da den Impuls, öffentlich Einspruch zu erheben, in Marias Namen und im Namen unserer Grundüberzeugungen. Wäre das nicht geradezu unsere moralische Pflicht, haben wir uns gefragt?
BZ: Warum haben Sie diese Frage dann verneint?
Friederike Ladenburger: Wir hielten es für richtig, eine rote Linie zwischen uns und den politischen Debatten zu ziehen. Eine rote Linie, die wir nicht überschreiten. Alles, was wir als unmittelbar Betroffene sagen würden, kann in einer aufgeheizten gesellschaftlichen Stimmung der von uns gewünschten Sachlichkeit der Debatte nur abträglich sein. Ich kann es auch andersherum sagen: Als trauernden Eltern fehlt uns letztlich die Distanz. Deshalb tun wir uns und unserer Familie, aber auch der Gesellschaft den besten Dienst, wenn wir uns dazu öffentlich nicht äußern.
Clemens Ladenburger: Unsere Antwort, unser Debattenbeitrag ist die Stiftung – und nur die Stiftung. Damit wollen wir ein Zeichen setzen, dass wir als Gesellschaft Taten des Hasses und kaltblütiger Menschenverachtung nicht mit Hetze und noch mehr Hass beantworten dürfen. Sonst droht eine zerstörerische Spirale, die an die Grundlagen unseres Miteinanders rühren kann. Dem möchten wir mit unseren bescheidenen Möglichkeiten entgegenwirken.
BZ: Sie sind aus dem rechten politischen Spektrum massiv angefeindet worden.
Friederike Ladenburger: Das war sehr, sehr schmerzlich, besonders wenn es auf zum Teil unflätigste Weise gegen unsere verstorbene Tochter ging.
BZ: Haben Sie Anzeige erstattet?
Clemens Ladenburger: Nein. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass alle diese Anwürfe weder mit uns noch mit unserer Tochter etwas zu tun haben. Und: Wir stehen auch so zu ihren und zu unseren Idealen.
Friederike Ladenburger: Trauer braucht das Private, den geschützten Raum. Dafür haben wir, glaube ich, ein sehr gutes Gespür entwickelt.
Clemens Ladenburger: Ich würde nicht von Hass oder Rache sprechen. Aber dass wir keine Momente der Bitterkeit, der Wut, auch der Niedergeschlagenheit und Resignation gehabt hätten, könnte ich sicher auch nicht behaupten.
Friederike Ladenburger: Ohne Zweifel mussten und müssen wir als trauernde Eltern einen schwierigen Weg gehen – wie viele andere Eltern auch. Die größte Kraftquelle war und ist – Maria selber. So jung sie auch war, sie hatte eine sehr reife und starke Art, den Blick auf das Positive zu lenken, auf das Tragende, auf den Halt in aller Zerrissenheit und allem Leid. Das haben wir gespürt, als dieses Leid sie selbst und dann auch uns aufs Grausamste getroffen hat.
BZ: Was ist dieser Halt?
Friederike Ladenburger: Unser Glaube. Wir sind Christen, und als Christen waren wir vom Moment der Todesnachricht an gewiss, dass es Maria gut geht, dass sie gut aufgehoben und bewahrt ist.
Clemens Ladenburger: Sie lebt weiter mit uns, und wir können uns auf ein Wiedersehen mit ihr freuen.
Friederike Ladenburger: Für diese Gewissheit sind wir sehr, sehr dankbar. Genauso wie für die starke, zukunftszugewandte Haltung unserer Töchter und für die große Solidarität und Unterstützung durch unsere Familie, durch wunderbare Freunde und Kollegen. In Momenten, in denen wir das Gefühl hatten, die Welt steht still, haben wir eine Liebe, eine Nähe, eine Kraft guter Menschen erfahren, für die es eigentlich keine Worte gibt.
Clemens Ladenburger: Wir haben gespürt, Gott gibt uns die Kraft, dieses Schicksal zu meistern. Er ist bei uns, er begleitet uns. Wir haben gemerkt: Es ist uns jetzt eine neue Lebensaufgabe zugewachsen, mit dem gewaltsamen Tod unserer Tochter zu leben, und wir können das schaffen. Das haben wir uns von Anfang an gesagt, und wir sagen es uns immer wieder. Und das Gefühl der Dankbarkeit, von der wir schon sprachen, hilft uns, all die anderen Gefühle nicht so sehr hochkommen zu lassen, dass sie die Oberhand gewinnen.
Friederike Ladenburger: Dankbarkeit, das ist unsere Erfahrung, gibt uns Halt. Aber daraus kann auch eine Haltung werden – ein Perspektivwechsel, der es erlaubt, auf das Positive zu schauen. Maria hat uns das vorgelebt. Sie war eine Mutmacherin.
BZ: Es war Ihre Tochter, die Sie so erzogen haben.
Friederike Ladenburger: Nein, nein, das glaube ich nur zu einem geringen Teil. Maria war jemand ganz Eigenes. Und wir haben sie so geschenkt bekommen, wie sie war.
BZ: Ein Geschenk, das Ihnen jäh und vor der Zeit entrissen wurde. Führt das nicht zwangsläufig auf die Frage hin: Wie kann Gott das zulassen?
Clemens Ladenburger: Gott wollte das nicht, was Maria angetan wurde. Gott will das Böse nicht. Aber er hat uns als freie Menschen erschaffen – und uns damit auch die Möglichkeit gegeben, Böses zu tun.
Friederike Ladenburger: Und das kann er dann auch nicht immer verhindern. Er hat nicht eingegriffen. Warum nicht? Ich weiß das nicht zu sagen. Noch am Abend des 16. Oktober 2016, an dem wir von Marias Tod erfuhren, haben wir uns gesagt: Wir werden nicht nach dem Warum fragen, weil es darauf keine Antwort gibt.
Clemens Ladenburger: Gott kann nicht alles Böse von uns fernhalten. Aber er ist im Leid gegenwärtig, und er teilt unser Leid. Das haben wir seit Marias Tod sehr wohl erfahren. Unser Gott steht uns zur Seite. Genau wie er Maria zur Seite steht.
BZ: Sie haben einmal gesagt, Ihnen sei in der Aufarbeitung der Tat wichtig, dass es möglichst nicht wieder zu solchen Verbrechen kommt, denen dann andere Menschen zum Opfer fallen. Schwingt für Sie im Begriff vom "Opfer" die Möglichkeit mit, dass es für all das einen tieferen, verborgenen Sinn geben könnte?
Friederike Ladenburger: Wenn Sie so von "Opfer" sprechen, fällt auch das in den Kontext des Glaubens. Das entspricht aber so nicht unserem Gottesbild. An dem, was Maria widerfahren ist, ist an sich nichts Gutes. Für uns nicht, aber auch für Gott nicht. Ob im Leben nach und mit Marias Tod etwas Gutes wachsen kann, das ist dann freilich eine andere Frage.
Clemens Ladenburger: Kann man diesem Tod einen Sinn abgewinnen? Das ist ja die Frage, um die es hier geht. Ich glaube, so sollten wir als Betroffene nicht fragen. Die Frage muss vielmehr sein: Was erwächst daraus für uns als Aufgabe, als Auftrag?
BZ: Sie haben vorhin zur Frage eines persönlichen Besuchs im Strafprozess gesagt, Maria hätte das nicht gewollt. Was, glauben Sie, will Maria – von Ihnen, von der Gesellschaft?
Friederike Ladenburger: Wir haben zu Marias Beerdigung einen Text von ihr ausgewählt, der von dem erwähnten Perspektivwechsel spricht. Ein Text, mit dem sie einmal einer Freundin Mut zugesprochen hat: "Du bist Teil eines riesengroßen Ganzen! Lass nicht den Kopf hängen, sondern schau auf und denke daran, dass wir vieles nicht verstehen können, aber auf eine ganz besondere Art und Weise etwas Gutes entsteht!" Aus dem Bösen, das uns trifft; aus Ereignissen, die wir nicht verstehen; aus alledem kann – durch den Beitrag jedes Einzelnen – Gutes wachsen. Ich glaube, diese Haltung will Maria uns mitgeben.
Clemens Ladenburger: In einer der vielen wunderbaren Zuschriften, die wir nach Marias Tod bekommen haben, stand ein Gedanke, der uns sehr angesprochen hat: "Vielleicht können Sie es auch so verstehen, dass Maria Sie als Eltern bittet, all die Liebe und Güte, die sie ihren Mitmenschen gezeigt hat und nun nicht mehr zeigen kann, nun an ihrer Stelle anderen weiterzugeben." Wir denken, genau das tut Maria.
Bankverbindung: Maria-Ladenburger-Stiftung, BW Bank, IBAN: DE90600501010405107199, bitte "Zustiftung" oder "Spende" angeben.
Website: Maria-Ladenburger-Stiftung
- Stellungnahme der Eltern von Maria Ladenburger (März 2018): Der Mord wurde angemessen geahndet
- Unterstützung von Studierenden: Eltern der getöteten Maria Ladenburger gründen eine Stiftung mit dem Namen ihrer Tochter